In einer anderen Presseinfo – dem „Newsletter“ der Stuttgarter Designer Jehs + Laub für diesen Monat – wird deren neues Sofa Jalis vorgestellt, das sie für die Firma COR im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück entworfen haben. Obwohl alle Beteiligten an dieser Dreieckskommunikation unzweifelhaft Deutsche sind, ist der Text komplett englisch („Talis for COR“). Ein Irrtum? Oder wissen die höflichen Schwaben, dass meine Frau aus Südwestengland stammt? Hier zeigt sich wohl eher jene anscheinend weiter zunehmende Tendenz zu deplaziertem Anglizismus, die, ob in Wissenschaft, Kultur oder Wirtschaft, längst zum öffentlichen Ärgernis geworden ist. Was mich daran interessiert, sind die Motive der massenhaften Sprachemigration, aber auch deren Folgen.
Was die Gründe angeht, steht sicherlich häufig ein falsch verstandener, oberflächlicher Globalismus dahinter, nur allzu oft sinnlos und verbunden mit purer Angeberei. Wie früher das Latein auf der Kanzel oder das Französisch der Adligen wird die neue dominante Globalhochsprache eingesetzt, um die Majorität, die sie unzulänglich oder gar nicht beherrscht und deshalb vor ihr Angst hat, zu beeindrucken und zu lenken. Dass Sprache ein Herrschaftsinstrument ist, dürfte allgemein bekannt sein. Mancheiner geht aber auch einfach nur mit der Mode, weil Englisch eben als chic gilt, man mit Speck Mäuse fängt oder weil es einfach opportun erscheint, auf dem anglizistischen Trittbrett mitzufahren. So greift etwa unter Museumskuratoren die Unsitte um sich, Ausstellungen ohne jeden Bezug auf deren Inhalt einen englischen Titel zu geben. Die eingangs genannte der Neurath-Ausstellung ist ein solch absurdes Beispiel. Andere, besonders lächerliches Beispiele, die regelmäßig ein in Kommunikationsgau enden, sind in Englisch abgefasste wissenschaftliche Traktate deutscher Wissenschaftler, die dieser Sprache offensichtlich gar nicht mächtig sind.
Der Grund für die Benutzung von Anglizismen liegt also häufig gerade nicht in kommunikativen, sondern in sprachfremden Zwecken. Zu den Folgen zählt eine entleerte, phrasenhafte Kommunikation, die nicht selten lächerlich ist und sich häufig mit unpassenden Sprachfedern schmückt. Weitere Hinweise zu diesen Auswüchsen gibt ein Aufsatz des Sprachwissenschaftlers Jürgen Trabant, der am 15. Dezember in der Süddeutschen Zeitung erschien. Unter der Überschrift „Die Sprachflüchter“ prophezeit der Professor dort nicht weniger als das Absinken des Deutschen zur Zweitrangigkeit im eigenen Land, während die Elite ihren Nachwuchs mehr und mehr auf Schulen schicke, auf denen „die neue Hochsprache“ Englisch ist. „Hoch-Deutsch ist dieser Elternschaft keine wertvolle Bildungssprache mehr, in der die kulturelle Entfaltung ihrer Kinder erfolgen soll“, malt Trabant den anglo-amerikanischen Sprachteufel an die Wand. Dabei sei dies eben keineswegs ein internationales Phänomen, sondern viel mehr typisch deutsch.
Als jemand der seit einigen Jahren auf dem Webportal formguide über Design aus Deutschland informiert, ist mir das gestörte Verhältnis zum eigenen Standort, zur eigenen Geschichte und zur eigenen Sprache gewiss nicht fremd. Daran ändert auch eine lustige Fußball-WM wenig. Über unsere fortschreitende Amerikanisierung – denn darum handelt es sich ja im wesentlichen – habe ich Mitte der neunziger Jahre das Buch Westwind herausgebracht, in dem auch ein kleines Lexikon der Amerikanismen (Seite 148ff) einen Eindruck davon gibt, wie die verschiedenen Sprachwellen im 20. Jahrhundert die Neuwörter ins Deutsche gespült haben und es natürlich dadurch auch ungemein bereicherten. Wie komplex die Infiltrierung ist, dafür steht nicht zuletzt das Wort Design, das sich hierzulande vor zwei, drei Jahrzehnten einbürgerte und das auch ein gutes Beispiel dafür ist, wie sich das importierte Fremdwort im neuen Kontext der Gastsprache verändert. Auf die ziemlich schräge Biografie des Wortes Design im Deutschen und dessen Tücken werde ich demnächst auf formweh noch näher eingehen. Ein Trugschluss besteht eben schon in der stillschweigenden Annahme, das Wort habe, weil es im Englischen und Deutschen dasselbe ist, auch die selbe Bedeutung. Natürlich ein Irrtum, der unausgesprochen bleibt. Allein durch die längere Geschichte – als Lehnwort aus dem Französischen – hat Design im Englischen eine viel weitere Bedeutung (hier steht es zum Beispiel auch für Idee oder für Konstruktion). Dagegen meint Design im Deutschen, wo es erst in den Achtzigerjahren in die Allgemeinsprache gelangte, ausschließlich die Produktästhetik und deren Gestaltung.
Was mir jetzt am Herzen liegt, ist die Warnung vorden kommunikativen Fallen durch gedankenlose Deutschvermeidung, wie sie auch in den eingangs erwähnten Beispielen zum Ausdruck kommt. Der dadurch vermeintlich eingehandelte Vorteil, nämlich global kompatibel zu sein, wird durch Identitätsverlust erkauft. Einmal davon abgesehen, was es heißt, das Potential, das in der deutschen Sprache steckt, einfach zu verschenken und in der einzigen Sprache, in der man Virtuosität erreichen kann, diese gar nicht mehr anzustreben. Hätte die Ausstellung über den Intellektuellen und Sprachtheoretiker Otto Neurath nicht auch einen zündenden Titel in der Sprache verdient, in der er selber zu Hause war und wahrscheinlich an die 95% der Ausstellungsbesucher?
Wer die eigene Sprache geringschätzt, ist nicht nur ignorant, sondern gibt den Anspruch auf, innovative kulturelle Impulse zu setzen. Denn die wachsen in aller Regel auf einem (sub-)kulturellen Nährboden, der sich in günstigen historischen Situationen in der Gesellschaft entwickelt und der natürlich sprachlich vermittelt ist, im besten Fall mit Witz und Schärfe. Beispiele, wo genau dies gelang, sind die „Neue Sachlichkeit“ der zwanziger Jahre und das „Neue Deutsche Design“ der achtziger Jahre, Bewegungen, deren Namen originär sind, die (sic!) ins Englische übersetzt werden und die sich auf verschiedenen kulturellen Feldern positiv niederschlugen, etwa auch in der populären Musik. Im Englischen werden wir dagegen immer die Langsamen, die Langweiligen und oft auch die Peinlichen sein. Selbst wenn wir nicht radebrechen wie ein Herr Oettinger in Brüssel .. bp
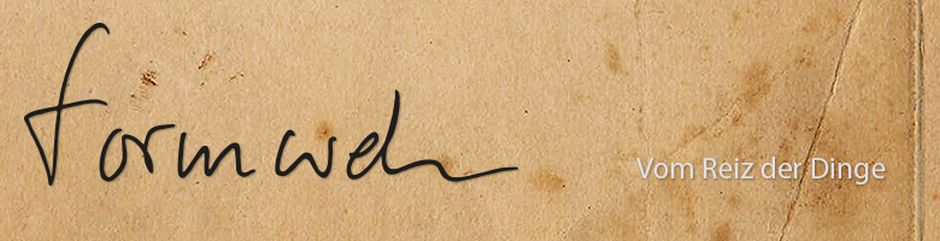
![[3]-Bildstatistisches-Elementarwerk-b-web](https://formweh.de/wp-content/uploads/2010/02/3-Bildstatistisches-Elementarwerk-b-web-150x150.jpg)


„Der Grund für die Benutzung von Anglizismen liegt also häufig gerade nicht in kommunikativen, sondern in sprachfremden Zwecken“
Sehr richtig! Meistens werden sie gebraucht, um sich zu erhöhen und andere auszugrenzen. Im Fall der Neurath-Ausstellung sicherlich auch, um internationales Publikum anzuziehen, allerdings wäre ein zweisprachiger Titel dafür kein Hindernis gewesen.
Zum Phänomen „Englisch als Wissenschaftssprache“ hat übrigens Stefan Klein am 6.7.07 in der FAZ einen guten Artikel geschrieben, der zu dem Schluß kommt: wir sind „Dümmer auf Englisch“.
Vielen Dank diese erfrischende nicht-konservative Sprachkritik!
I would like to thanks a ton for the work you’ve put in writing this web site. I am hoping the same high-grade webpage post from you in the upcoming also. The fact is your original writing abilities has inspired me to get my own site now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is the best example of it.
My site is what causes acne
Happen to be trying to find this and learned much more than anticipated in this article. Thanks.
My website is on Stock quote