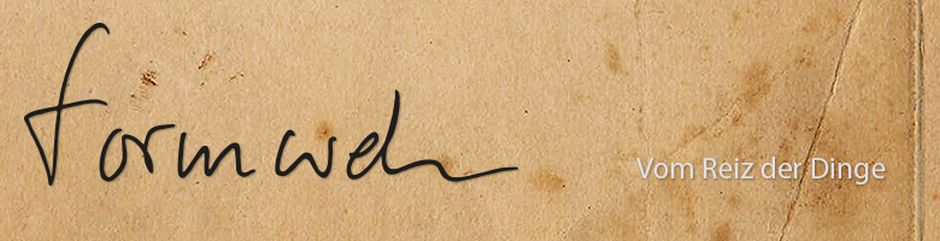Als neulich der Finanzvorstand der Telekom, Herr Timotheus Höttges, dem Bonner Generalanzeiger ein Interview gab (erschienen 24.12.2011, Seite 15), gehörte erstaunlicherweise „Kultur“ zu den meistbenutzten Worten. So erkundigte sich der Interviewer gleich am Anfang danach, wie der in Solingen gebürtige Höttges, der sich auch schon einige Jahre in München umtat, das „kulturellen Angebot der Stadt“ Bonn denn eigentlich so findet.
Wohlgemerkt das „Angebot“, nicht die Kultur der Stadt (und die, die sie schaffen). Die Antwort passte: „Für unsere Mitarbeiter ist zunächst die Infrastruktur entscheidend, zum Beispiel Kindergärten und Schulen. Auch Themen wie Sicherheit und Verkehrsanbindung spielen eine wichtige Rolle.“ Na, klar. Aber dann wies der geradeaus denkende Manager auch noch der Kultur ihren Platz zu, und zwar nach Feierabend. Denn: „Erst danach kommt das Thema Freizeitangebot, wozu auch die Kultur zählt.“ Nun wissen wir es aus berufenem Munde, was wir immer schon geahnt haben: Kultur ist ein kleiner Teil des Freizeitangebots, also ungefähr wie Fernsehen oder Jogging. Letzteres soll übrigens eine Leidenschaft von Herrn Höttges sein, der in Godesberg wohnt.
Ansonsten erfährt der Zeitungsleser leider recht wenig über den Antwortgeber. Dabei zeigt der bekennende Katholik doch auch außerberuflich Engagement (zum Beispiel in der selbst initiierten „Bürgerstiftung Rheinviertel“) und soll, wie man hört, als Chef wohl eher den harten Hirten geben. Auch ob und in welcher Verbindung er war, kommt nicht zur Sprache. Obwohl das hintersinnige Telekom-Motto („Erleben, was verbindet“) doch dezent darauf hinzudeuten scheint.
Stattdessen kommt der Telekom-Lenker noch auf dies und das zu sprechen, zum Beispiel, dass die Förderung junger Leute („eine Herzensangelegenheit“) zur „Philosophie“ des Magenta-Konzerns gehört, dass unsere Städte sich Kultur im heutigen Umfang wahrscheinlich bald nicht mehr leisten können und dass er den plötzlichen Exitus der „Rheinkultur“, Deutschlands größtem Freiluftumsonstrockfestival, doch ziemlich bedaure. Nun, er ist ja auch 1962 geboren, also im Jahr von „Love me do“, der ersten Hitsingel der Beatles. Und die hat sich wahrscheinlich schon ununterbrochen auf dem Plattenteller gedreht, als er noch im Bauch seiner Mutter weilte. Soetwas kann prägend sein. Da liegt vielleicht eine Ursache für den deutlichen Hang zu Anglizismen und zur Musikkultur überhaupt.

Kultur kann manchmal unberechenbar sein. Konzert der Gruppe Canalterror in den Bonner Rheinterrassen, 1981 (Foto canalterror.punknet.de)
Nun wundert den Leser auch gar nicht mehr, dass die Telekom nicht nur diese sagenhafte „Beethoven Competition“ veranstaltet (wie hätte sich der Meister, der sogar in Wien breitestes Rheinisch gesprochen haben soll, über diesen hübschen Namen gefreut), sondern auch Popmusik fördert, wie etwa diese coolen „Street Gigs“ in der Einkaufspassage. Wahrscheinlich gar nicht allzu weit entfernt von einem Telekom-Shop. Denn Kultur hin, Kultur her, am Ende kommt ihre Förderung natürlich nur in Frage , wenn sie „einen Mehrwert für unsere Märkte liefert“. Fragt sich, wie man das bei der Kultur – die ja manchmal unberechenbar sein soll – immer so genau ausrechnen kann? Aber die Telekom verfügt ja schließlich über sehr große Computer. bp