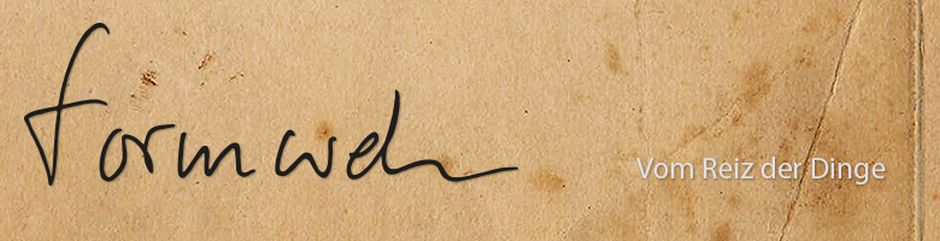Nein, natürlich nicht. Wie denn auch in einem Land, dessen Landlords in den letzten zwei Jahrhunderten lieber fischen und jagen gingen, sei es auf ihren weitläufigen Gütern oder in den warmen Kolonien des Südens? Und die liegen bekanntlich weit weg von den Fabriken im Norden Englands, wo der Wind zwar kalt über karge Hügel pfeift, aber wo das Design eben dummerweise herkommen müsste. In solch einem Land erfindet man Kriminalkommissare, Cricket, Clubs und den dazugehörigen Gentleman, dann vielleicht noch die Seaside, die Countryside und die Hedgefonds – aber gewiss kein Industriedesign.
Das ist deshalb bis heute ein rares Gut. Da braucht man nur jemanden wie James Dyson zu fragen, einen Fabrikanten aus England und damit selbst eine eher rare Spezies. Der würde das ach so gerne ändern (hat sogar einen Preis gestiftet), aber schafft es alleine natürlich auch nicht. Der erste große Designer, den England hervorbracht hat, nämlich William Morris, hätte alle Maschinen am liebsten im Ärmelkanal versenkt. Das konnte ja nichts werden. Dann war da noch dieses Problem mit der Mechanik, das in der englischen Auto- und Spielzeugindustrie öfter mal auftauchte. So besaß der „Morris Minor“, Englands erstes Volksauto (konstruiert von dem berühmten Alexander „Alec“ Issigonis), eine besondere Eigenschaft: Das liebenswerte Gefährt verlor bei Linkskurven manchmal ein Vorderrad. Auch Dyson hat sich mit der Rotation rumschlagen müssen, als er zum Bespiel eine total innovative Waschmaschine auf den Markt bringen wollte aber nicht konnte. So kam es zu der merkwürdigen Situation, dass der Engländer zwar mit seiner Dampfmaschine die Welt erobert hat, ihren Nachfolgerinnen aber nicht recht traut. Andererseits jedoch hat er völlig neuartige Apparaturen entwickelt, die in den Maschinensälen der „Kreativindustrie“ stehen. bp
 Weitere, teilweise ergreifende Erkenntnisse zu diesem spannenden Themenkomplex stehen in einem brandneuen Buch. Titel: Und kann man darauf auch sitzen? Wie Design funktioniert (250 Seiten, etwa 50 Abbildungen). Das Werk ist im Dumont- Buchverlag erschienen und kostet nicht mal 15 Euro.
Weitere, teilweise ergreifende Erkenntnisse zu diesem spannenden Themenkomplex stehen in einem brandneuen Buch. Titel: Und kann man darauf auch sitzen? Wie Design funktioniert (250 Seiten, etwa 50 Abbildungen). Das Werk ist im Dumont- Buchverlag erschienen und kostet nicht mal 15 Euro.