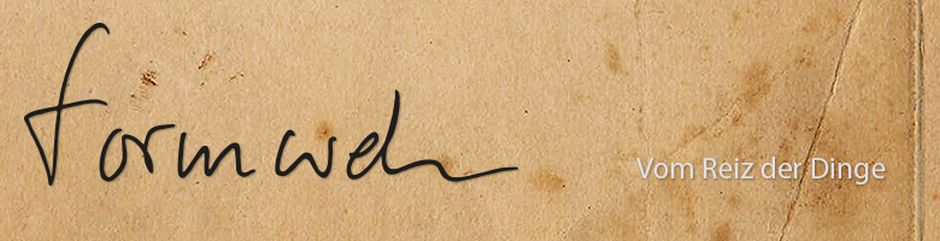Deutschland 1920. Als der Bildhauer und Wandervogel Josef Hartwig 1921 durch Thüringen tippelte, kam er mehr oder weniger zufällig auch am Weimarer Bauhaus vorbei und der Direktor Walter Gropius bat den langhaarigen Kunsthandwerker (der dann später angestellt wurde) in sein Büro. Da war der Tippelbruder, immerhin schon Anfang 40, ziemlich beeindruckt von dem einen gelben Sessel, in dem Gropius saß.
Er wirkt geschlossen, massiv und repräsentativ. Walter Gropius entwarf diesen zu Unrecht weniger berühmten Sessel für sein eigenes Weimarer Direktorenzimmer. Er geriet dem Gründer des Bauhauses zu einem programmatischen Möbelstück. Unterstrichen wurde dies noch durch den maximalen farblichen Kontrast von dunklem Kirschbaumholz und einem Wollbezug in grellem Gelb. Der Entwurf entstand zu einem Zeitpunkt, als sich die neu gegründete Hochschule noch in einer Selbstfindungsphase befand und die künftige Richtung keineswegs entschieden war. Gropius realisierte im selben Jahr das Haus Sommerfeld mit deutlich expressionistischen Anklängen.
Mit dem Sessel, eines der ersten Polstermöbel, das mit der Tradition seines Genres konsequent bricht, schuf er ein geometrisches Konstrukt und knüpfte an eigene sachliche Vorkriegsarbeiten an, wie etwa das Fagus-Werk von 1911. Der F 51 ist Teil der Architektur, aber auch in sich zeigt der Entwurf Linientreue. Er besteht aus der Kombination unterschiedlicher Kuben. Charakteristisch ist das Holzgestell, das von außen sichtbar einen Kragarm bildet. Die freitragende Bauweise deutet bereits auf die späteren Freischwinger hin. In seinen einfachen, rechtwinkligen und miteinander verschränkten Formen – hervorgehoben durch den stärksten aller Fabkonstraste – spiegeln sich rationale und konstruktive Prinzipien, wie sie zu jener Zeit etwa bereits bei Möbeln des Österreichers Josef Hoffmann und des Holländers Gerrit Rietveld zu finden waren. Sie wurden später zum Markenzeichen des Bauhauses, nicht zuletzt durch die Möbel des Gropius-Mitarbeiters Marcel Breuer. Auch die Wiege und der Kubussessel von Peter Keler sowie Entwürfe von Ludwig Mies van der Rohe gegen Ende der zwanziger Jahre knüpfen auf unterschiedliche Weise an die neue Sitzsachlichkeit an. Der F 51 als Ganzes, wie auch das Holzgestell allein, formen einen Würfel, in den der Sitzraum „eingeschnitten“ wurde. Damit bildete er das Empfangszimmer ab, das ebenfalls ein Würfel war. Diese Systematik entsprach dem schon aus der Werkstätten- und Werkbund-Bewegung der Vorkriegszeit bekannten Konzept des Gesamtkunstwerks. Hier wurde es erstmals in seiner minimalistischen Variante verwirklicht. In seinen berühmt gewordenen „Isometrien“ stellte Herbert Bayer genau diese umfassenden und visionären Raumbeziehungen dar.
Bernd Polster
Der Text erschien urprünglich in dem Buch: bauhaus design. Die Produkte der Neuen Sachlichkeit, Köln 2009