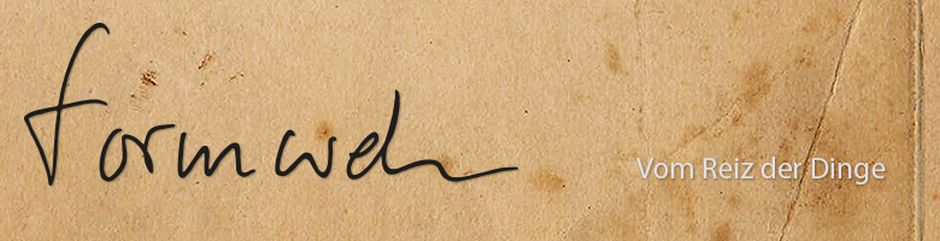Vor zehn Jahren ging in München der „Partybär“-Prozeß zu Ende, ein Verfahren, bei dem ein stattliches Aufgebot von Zeugen sich eine streckenweise durchaus TV-reife Schlammschlacht lieferte. Grund der juristischen Reality-Komödie: Ende der neunziger Jahre entwickelten sich die Leuchten in Bärenform zu einer Art Tamagotchi des Wohndesigns. Zeitweise wurden pro Monat über 300 000 „Partybären“ abgesetzt. Aber nicht alle waren echt. Gleich eine ganze Reihe von Firmen hatte den Bestseller kopiert. Eine wurde daraufhin vom Originalhersteller verklagt. Obwohl der Tatbestand eindeutig zu sein schien, war der Ausgang des Verfahrens jedoch keineswegs sicher. Am Ende gab es keinen Sieger. Plagiatoren zahlten entgangene Lizenzen nach. Der Leuchtbärenmarkt war tot.
Klagen gegen „Produktpiraterie“ – wie der Ideenklau auf Gerichtsdeutsch heißt – haben einen hohen Unsicherheitsfaktor. Einer der ein Lied davon singen kann, was es heißt, sich auf rechtlichem Wege gegen Plagiatoren durchzusetzen, ist Hansjerg Maier-Aichen. Der Gründer und Inhaber der Hausartikelfirma Authentics, die eng mit internationalen Designern zusammenarbeitete, zählte mit seinen farbenfrohen Kunststoffprodukten zu den meistkopierten Herstellern. Maier-Aichen hat etliche Prozesse dagegen geführt. Letztendlich war es ein „Kampf gegen Windmühlenflügel“. Maier-Aichen verzichtete schließlich ganz auf juristische Gegenwehr. Ausschlaggebend für diese resignative Haltung war nicht zuletzt eine lang andauernde Auseinandersetzung mit Ikea. Der schwedische Möbel- und Einrichtungskonzern hatte den Kunststoff-Becher „Cono“ kopiert, eines der erfolgreichsten Authentics-Produkte. Der daraufhin angestrengte Prozeß, der sich äußerst kompliziert gestaltete, endete schließlich mit einem Vergleich. Und dass obwohl man eindeutig nachweisen konnte – insbesondere anhand der unregelmäßigen Wandstärke, die beim Original und beim Plagiat identisch sind -, dass der Becher, der bei Ikea als „Episk“ herauskam (und nur eine Mark kostete), eins-zu-eins abgekupfert war. Das Paradox: obwohl „Episk“ deshalb auch als Plagiat bezeichnet werden durfte, hatte Ikea das inkriminierte Produkt weiterhin im Sortiment. Authentics ging kurz darauf pleite und wurde verkauft.
Der Fall kam an die Öffentlichkeit, als Ikeas „Episk“ den „Plagiarius“ verliehen bekam, eine Art Anti-Preis, den der Designer Rido Busse für die dreistesten Nachahmungen vergibt. Das Negativetikett wird den Übeltätern jedes Jahr auf der Frankfurter Designmesse „Ambiente“ angeheftet. Die Sammlung mehr oder weniger eleganter Fälschungen, die so mit der Zeit zusammen kamen, ist beeindruckend und soll demnächst in einem Designmuseum ganz anderer Art gezeigt werden. Nachdem der Prozeß gegen Authentics zuende war, versuchte Ikea übrigens, die peinliche „Auszeichnung“ an Rido Busse zurückzugeben. Die medienwirksam inszinierte Aktion mißlang jedoch, da dieser sich strikt weigerte. Busse, selbst ein Geschädigter des Ideenklaus, gilt in der Branche als hartnäckigster Verfechter starker Schutzrechte.
Der „Plagiarius“ – ein schwarzer Gartenzwerg mit golden lackierter Nase – wurde 1977 erstmals verliehen. Der Gnom zeigte Wirkung. Heute hilft häufig schon der Hinweis eines Herstellers, dass man beabsichtige, Original und Fälschung bei Busse einzureichen, um einen Trittbrettfahrer dazu zu bewegen, seine Raubkopie wieder vom Markt zu nehmen. Was das rechtliche Instrumentarium betrifft, hat sich die Situation der betroffenen Firmen hierzulande ebenfalls deutlich verbessert. Auch dies ist nicht zuletzt auf Busses Aufklärungsfeldzug zurückzuführen. Ein 1990 eingeführtes Gesetz droht mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis. Die ist allerdings noch nie verhängt worden. Daraus zu folgern, daß es sich beim Designdiebstahl um eine Marginalie handelt, ist jedoch weit gefehlt. Der Schaden, den die professionellen Trittbrettfahrer jährlich verursachen, wird von Experten weltweit auf mehrere hundert Milliarden Mark geschätzt. Eine Summe, die plausibel erscheint, wenn man weiß, daß bereits um 2000 an deutschen Grenzen jährlich Waren im Wert von rund 40 Milliarden Euro unter dem Verdacht beschlagnahmt wurden, dass sie Schutzrechte verletzen würden. Inzwischen sind Polizeieinsätze auf Messen keine Seltenheit mehr. Insbesondere mittelständische Betriebe, die in Design und technische Innovationen investieren, leiden unter denen, die sich dieses Geld sparen. Die Zahl der auf diese Weise vernichtetenArbeitsplätze dürfte beträchtlich sein. Ein prominentes Opfer war die Modefirma MCM, die gegen die Masse der Plagiatoren einfach nicht mehr ankam und schließlich aufgab.
Den Widerspruch zwischen dem erheblichen wirtschaftlichem Schaden und der Ohnmacht gegenüber dem fortgesetzten Ideenklau führen betroffene Firmen nicht zuletzt auf die Unentschlossenheit der Gerichte zurück. Für viele Richter ist Design ein terra incognito. Und da der Diebstahl einer Idee ohnehin häufig Ermessenssache ist, gilt das ganze Thema als unsicheres Terrain. Zahlreiche Verfahren werden erst gar nicht eröffnet oder enden im Vergleich. Da sinkt die Bereitschaft, überhaupt ein Gericht anzurufen. Allein hasenfüßige Juristen für die unbefriedigende Situation an der Plagiatsfront verantwortlich zu machen, greift allerdings zu kurz. Dass die Plagiatsindustrien blühen – und zwar mittlerweile nicht nur im Fernen Osten, sondern auch in Osteuropa und in Ländern wie der Türkei -, verweist zuallererst auf eine hohe Nachfrage.
Tatsächlich handelt es sich bei den Abnehmern in den Industrieländern ja häufig gar nicht um dubiose Dunkelmänner. Darunter befinden sich auch große Namen. Ein Beispiel lieferte die Lufthansa. Die Catering-Abteilung der Renommier-Airline verwendet einen nachgemachten Korkenzieher der holländischen Designfirma Brabantia und wurde dafür von Busse mit einem „Krämerseelenpreis“ bedacht. Wird soetwas ruchbar, beruft man sich zumeist auf Unwissenheit. Auch die Supermarktkette Tengelmann war in einen Fall von Designdiebstahl verwickelt: jene so beliebten Küchenwerkzeuge aus Edelstahl, die man an ihren Rundgriffen an die Wand hängen kann, und die Tengelmann äußerst preiswert angeboten hatte, waren nicht vom Originalhersteller. Hierbei handelt es sich um eines jener typischen Trendprodukte, die Plagiatoren magisch anziehen, weil die schnelle Mark lacht. So war es sicher kein Zufall, daß ähnliche Küchenutensilien auch in den Läden des Kaffeerösters Tschibo auftauchten, und zwar ebenfalls in einer Coverversion.
Tschibo, eine Firma, die sich zu einem Billiganbieter für Konsumprodukte aller Art entwickelt hat, gerät immer wieder ins Visier der Designschützer. So wundert es kaum, dass Tschibo auch eine stattliche Zahl von „Plagiarius“-Preisen vorweisen kann. Die Kombination aus äußerst effektivem Vertrieb – das bedeutet hoher Absatz eines Plagiats, bevor dieses überhaupt entdeckt wird – verbunden mit einer Preisgestaltung, die einen eventuellen Schadenersatz bereits einkalkuliert, ist das dahinter steckende Erfolgsgeheimnis. Hier wird das Plagiat geradezu zum Geschäftsprinzip. Da half es auch nicht viel, dass Tchibo 2008 sein Image durch eine neue „Kollektion“ des Briten Terence Conran aufzumöbeln versuchte.
Ganz ähnlich liegt der Fall bei Ikea, ein Unternehmen, das sich auf nachempfundene Billigversionen angesagter Designtrends spezialisiert hat. Ein Bummel durch ein Ikea-Kaufhaus ist deshalb auch eine Exkursion in die Designgeschichte und könnte einen Besuch im MoMA ersetzen. Nicht nur skandinavische Klassiker wie Alvar Aalto oder Poul Henningsen haben Ikeas Hausdesigner unübersehbar inspiriert. Auch internationales Design findet immer wieder seinen Weg in den berühmten Ikea-Katalog. So übertraf die Ikea-Variante des Kunststoffklappstuhls „Plia“, die der Italiener Giancarlo Piretti in den sechziger Jahren entworfen hatte, die Auflage des Originals um ein Vielfaches. Der Möbelmulti vertritt diese Politik mittlerweile offensiv. Man versteht sich als Anbieter von „demokratischem Design“, eine Formulierung, die sich der Zustimmung einer Kundschaft sicher weiß, der ein günstiges Angebot allemal wichtiger ist als die Frage nach der geistigen Urheberschaft. Die Prozesse, mit denen die Firma deshalb seit Jahrzehnten überzogen wird, hat sie in der Regel erfolgreich abgewehrt. Das schreckte jedoch nicht den deutschen Möbelunternehmer Niels-Holger Moormann, der zu den ganz kleinen Feinen gehört, gegen den Giganten aus Schweden anzugehen, als er seinen Tischbock »Taurus« bei Ikea unter der Bezeichnung „Sture“ entdeckte. Moormann, dessen Firma als eines der innovativsten deutschen Möbelhäuser gilt, sah sich um seine Entwicklungsarbeit betrogen, ein durchaus exemplarischer Fall. Nachdem Moormann die beiden ersten Instanzen bereits gewonnen hatte, zog Ikea vor den Bundesgerichtshof – doch der nahm den Fall gar nicht an.