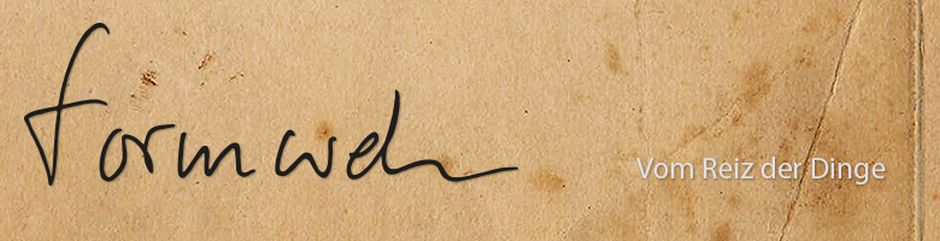Die Fraktionsräume im Berliner Reichstag sind mit dem »Freischwinger« von Mart Stam ausgestattet, einer Möbelinnovation der zwanziger Jahre. Designklassiker aus dieser Zeit sind längst prestigeträchtige Statussymbole mit geradezu staatstragenden Qualitäten. So orderte das Bundespräsidialamt Sitzmöbel von Ludwig Mies van der Rohe, einem der bekanntesten deutschen Designer der Bauhaus-Ära. Dass sich auch die Gäste bei ARD-Talkshow am Sonntagabend auf Stühlen von Mies räkelten, passte da nur ins Bild. Der Fauxpax: Die illustren Gesprächspartner saßen auf unautorisierten Nachbauten.
Wer hierzulande einen Klassiker herstellen und vertreiben will, braucht dazu eine Lizenz. Die lag in diesem Falle bei der Möbelfirma Knoll, die die No-Names erkannte und unbürokratisch ersetzte. Die offiziellen Hersteller der Möbelklassiker sind jedoch keineswes immer so kulant. Nicht wenige beschäftigen Detekteien, die insbesondere in Neubauten einen argwöhnischen Blick auf das noble Mobiliar werfen. Bekannt wurde die Affäre um das Berliner Grandhotel Esplanade, das seine Gästezimmer unter anderem mit Ledersesseln des schweizer Designers Le Corbusier ausgestattet hatte. Ein Designschnüffler der italienischen Firma Cassina – die dafür das Monopol besitzt – hatte beim Probewohnen entdeckt, daß es sich um Produkte aus unbekannter Quelle handelte. Das Berliner Landgericht verurteilte die Nobelherberge daraufhin, die inkriminierten Polstermöbel in über hundert Zimmern und Suiten zu ersetzen.
»Notwendige Apparate des Lebens« wollte der Bauhaus-Designer Marcel Breuer mit seinen Möbeln schaffen. Und sein Zeit- und Gesinnungsgenosse Le Corbusier erklärte kategorisch: »Ein Stuhl ist auf keinen Fall ein Kunstwerk.« Die Meister der klassischen Moderne sahen ihre Entwürfe als Gebrauchsgegenstände und wollten deren Bedeutung deshalb auf ihre reine Funktion reduziert wissen. Die deutsche Justiz ficht das nicht an. Seit Ende der achtziger Jahre wurden Le Corbusiers Sessel »LC2« sowie die Liege »LC4« in einem Musterprozeß als Kunstwerke im Sinne des Urheberschutzgesetzes anerkannt. Seitdem gehen hierzulande nur die Modelle von Cassina als »Original« durch.
Andere Unternehmen, die solcheine einträgliche Lizenz in ihren Besitz gebracht haben, sind unter anderem Classicon (Möbel von Eileen Gray), Fritz Hansen (Stühle und Sessel von Arne Jacobsen), Tecta (Sitzmöbel von Marcel Breuer, Walter Gropius und Mies van der Rohe), Tecnolumen (Leuchte von Wilhelm Wagenfeld) und Thonet (Sessel von Mart Stam und Mies van der Rohe) – allesamt renommierte Marken, die für exzellente Verarbeitung und satte Preise stehen. Seit Designobjekte hierzulande höchstrichterlich in den Olymp geschützter Kunstwerke erhoben wurden, lösten die Monopolisten eine wahre Prozeßlawine aus. In hunderten von Fällen mußten Möbel, denen es am rechten Markenzeichen und häufig auch an Qualität mangelte, vom Markt genommen und Lagerbestände vernichtet werden.
Die inkriminierten Designobjekte kommen zumeist aus Italien und Spanien, Länder in denen sich das künstlerische Copyright nicht auf Möbel und andere Alltagsprodukte erstreckt. Dort hat sich eine ganze Branche auf die Produktion preiswerter Klassiker-»Plagiate« spezialisiert, darunter jede Menge Klitschen, aber auch Hersteller, wie etwa die italienische Firma B.R.F., die mit Klassikern wie Le Corbusier Millionenumsätze macht und sie in zahlreiche Länder exportiert. »Allein auf juristischer Ebene läßt sich das Problem nicht meistern«, meint angesichts dessen ein Anwalt der Firma Knoll. »Die Plasgiatoren«, klagt er, »sind wie eine Hydra«. Vermehrte sich diese vormals in erster Linie per Kleinanzeige, bedienen sich die professionellen Designkopisten mittlerweile zunehmend virtueller Methoden. Das Angebot von Möbelklassikern im Internet boomt und ist kaum noch kontrollierbar. Ähnlich wie in der Musikbranche scheint hier das Urheberrecht zu korrodieren, weil es der Kommunikationsgesellschaft nicht mehr entspricht.
Die Geschichte des modernen Designs war auch eine Abfolge juristischer Auseinandersetzungen. Bestes Beispiel: die Stahlrohrmöbel der Vorkriegszeit. 1932 verklagte zum Beispiel Thonet die Kopenhagener Firma Fritz Hansen, ein Hersteller, der heute selbst rigoros gegen jede unbefugte Herstellung seiner eigenen Klassiker zu Felde zieht. Die Dänen hatten damals offensichtlich einen hinterbeinlosen Stuhl von Mart Stam abgekupfert – den berühmten »Freischwinger«, um den es seit seiner Entstehung heiß her gegangen war. Daß selbst die Meister der Moderne es in Fragen der Urheberschaft nicht immer ganz genau nahmen, zeigt folgenes Beispiel. Als der Holländer Stam Mitte der zwanziger Jahre seinem Kollegen Mies van der Rohe seinen »Freischwinger« erläuterte, hatte der nichts Besseres zu tun, als flugs eine eigene Version der Stamschen Idee herauszubringen. Stam sicherte sich später auf gerichtlichem Wege die Rechte an seiner Erfindung.
Hinter dem Hickhack um die Klassiker stand von Anfang an die grundsätzliche Frage nach Original und Fälschung. Kann eine solche Unterscheidung bei einem industriell geferigten Serienprodukt überhaupt greifen? Meint der Begriff des Originals nicht etwas Einmaliges? Dann wäre höchstens der Prototyp des Designers als solches zu bezeichnen und der Anspruch heutiger Hersteller auf Authentizität grundsätzlich fragwürdig. Genau diese Auffassung vertritt auch der Kölner Galerist Ulrich Fiedler, ein intimer Kenner der Möbelmoderne, der sich als »Design-Archäologe« bezeichnet. Fiedler sieht in den Originalmodellen der 20er Jahre »Relikte einer Utopie«. Jeder Nachbau eines Klassikers kann dagegen nicht mehr sein als ein – mehr oder weniger solide ausgeführtes – Stilmöbel, eine moderne Form des Historismus.
Die Problematik um Original und Fälschung kommt bereits in Wortschöpfungen wie »Original-Reproduktion« zum Ausdruck, einem Widerspruch in sich. Wohl eines der markantesten Beispiele für das zeitgemäße Tuning eines angeblich sakrosankten Klassikers ist Marcel Breuers sogenannter »Wassily«-Sessel, inzwischen der Inbegriff für den fortschrittlichen Geist des Bauhauses und für klassisch-modernes Möbeldesign überhaupt. Aber was hat ein hochglänzender verchrohmter Stahlrohrsessel mit fester Lederbespannung eigentlich noch mit dem ursprünglichen Entwurf gemein? Breuer konstruierte verschiedene Versionen seines epochalen Sitzmöbels. Der erste Prototyp war vernickelt, hatte statt Kufen vier seperate Füße und war fest verschweißt. Breuer wollte ein leichtes, bewegliches Möbelstück schaffen. Dies entsprach dem funktionalistischen Konzept eines flexiblen Wohnstils, wie ihn die Bauhäusler propagierten. Aus diesem Grund wurde für die Bespannung eines besonderes Material entwickelt: Eisengarn, ein leichter aber strapazierfähiger Stoff. Der Breuersche Ur-Sessel wog viereinhalb Kilo. Das aktuelle Lizenzmodell – inzwischen im Sortiment der Firma Knoll – bringt dagegen rund zehn Kilo auf die Waage, also mehr als das Doppelte.
Marcel Breuer hatte seinen Sessel sachlich als »B3« numeriert. Im Zuge der Globalisierung firmiert das Stück inzwischen zumeist als »Wassily Chair« (nach Breuers Künstlerkollegen Wassily Kandinski). Wer die Luxusvariante von Breuers Geniestreich erwirbt, ist also alles andere als der Besitzer eines Originals. Der Nachbau hat mit Breuers ursprünglichen Ideen in etwa soviel zu tun wie der »New Beetle« mit dem Volkswagen der dreißiger Jahre.
Beim Streit ums Originaldesign kommt es zu einer innigen Verknüpfung kommerzieller Interessen mit der künstlerischen Aura. Die Vielfalt der Entwürfe wird dabei auf einzelne Entwürfe und Personen reduziert. Dies funktioniert auf dem Markt spätestens seit den designverrückten achtziger Jahren. Seitdem huldigt die Branche einer Art Starsystem nach hollywoodscher Manier. »Mart Stam«, sozial engagierter Architekt und Eigenbrötler, ist heute ebenso ein eingetragenes Markenzeichen wie »Marcel Breuer«.
Knolls unbefangener Umgang mit Breuers Original ist dabei keineswegs ein Einzelfall. Daß es Le Corbusiers Sessel »Grand Confort« inzwischen auch als Sofa gibt, ist ebenfalls eine reine Marketingidee. Nach einer Original-Zeichnung des »Meastros« – so der Titel der Serie bei Cassina – würde man vergeblich suchen. Ähnliche Gestaltungsfreiheit nahmen sich auch andere Hersteller, wie etwa Fritz Hansen bei der »7er-Serie« von Arne Jacobsen. Der Sperrholzstuhl der als erstes massenproduziertes Möbelstück gilt, wird seit den neunziger Jahren in einer breiten Farbpalette angeboten, die von Giftgelb bis Feuerwehrrot reicht. Angesichts dieses fröhlich-bunten Spektrums mag sich Jacobsen, ein Stil-Purist, der nur neutrales Beige und Grau akzeptierte, schon ein ums andere mal im Grabe umgedreht haben.