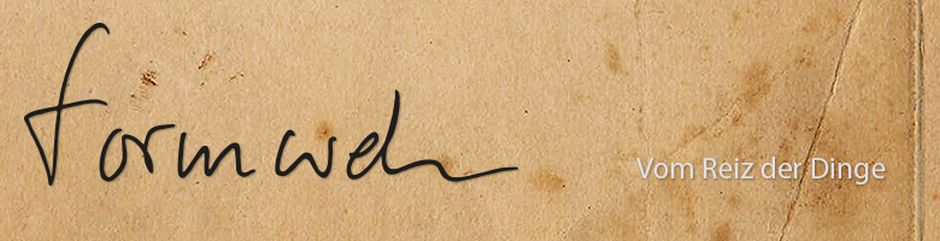Herrn Toprakci schwante Schlimmes. Weil die Architektur seiner vor 10 Jahren neu eröffneten Station so gar nicht in das gängige Schema passte, befürchtete der erfahrene Benzinverkäufer, dass Autofahrer einfach daran vorbeifahren würden. Dabei handelte es sich tatsächlich um eine der ungewöhnlichsten Tankstellen, in deren Biografie sich die Geschichte ihres unsteten Metiers spiegelt. Das hervorstechendste Merkmal ist das Vordach: eine Schalenkonstruktion aus Beton mit fast zwanzig Meter Spannweite, die sich rochengleich über die Zapfsäulen schwingt und so kühn wirkt, dass sich 1959 bei der Einweihung niemand darunter stellen mochte. Dass wir heute wieder unter diesem Dach stehen können, verdanken wir nicht zuletzt der Beharrlichkeit des Kölner Stadtkonservators, der den verrottenden Wirtschaftswunderbau in die Denkmalliste eintragen ließ und sich vehement gegen einen Abriß stemmte. Nach der Ölkrise der siebziger Jahre war dieses Mahnmal des ewigen Aufschwungs – wie tausende anderer Tankstellen aus den flotten Fifties – aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen worden.
In den letzten Jahrzehnten glichen sich die Tankstellen immer mehr an. Ihr vorgefertigtes Design lässt kaum noch Gestaltungsspielraum. Dies war keineswegs immer so. In der ökonömischen Schönwetterphase nach dem Zweiten Weltkrieg huldigte man mit spektakulären Spritpalästen dem Anbruch des goldenen, Auto fahrenden Zeitalters. Besonders in Deutschlands zerbombten Städten, in denen genügend zentrale Bauflächen zur Verfügung standen, ließ die Benzineuphorie der Wiederaufbaujahre den Architekten ein nie gekanntes Ausmaß an experimenteller Freiheit. Manche Tankstellen sahen nun aus wie fliegende Untertassen, andere waren so kantig wie das Bauhaus. Tankstellen wurden hierzulande auch zu Lieblingsobjekten kommunaler Repräsentation. So wurde in Hannover eine Tankstelle direkt gegenüber dem alten Rathaus errichtet. Ihre großzügige Rundumverglasung und ihr verspieltes, kleeblättriges Betondach verbanden sich zu dem erwünschten atemberaubenden Gesamteindruck. Auch diese Station wurde später denkmalgeschützt und ist – wie ihr Kölner Pendant – durch Umbau vor der Abrißbirne gerettet worden.
Als der Unternehmer Selhattin Toprakci, ein Deutscher kürkischer Herkunft, Ende der neunziger Jahre Kölns originellste Tanke wieder zum Leben erwecken wollte, waren sich professionelle Tankstellenplaner und Bankfachleute darüber einig, daß dies keinesfalls möglich sei. In der Tat stellte sich eine komplizierte Aufgabe, bei der unterschiedlichste Gesichtspunkte zu berücksichtigen waren: neben den Auflagen des Denkmalschutzes und den Vorgaben des Mineralölkonzerns Esso, der die Investitionen für die Technik übernahm, sollten auch Toprakcis eigene kaufmännische Überlegungen einfließen. Darunter auch die bange Frage, ob der gemeine Autofahrer die ambitionierte Station überhaupt als solche erkennen würde. Der mit dem Umbau betraute Architekt Walter Krause vom Kölner Büro Stadtarchitekten hat deshalb Shop und Wartungshallen mit einer feinen, an der Dachkante entlanglaufenden Lichtleiste versehen, die das Gebäude in seinen Proportionen deutlich markiert.
Weil die Tanksäulen und der Weg zum Shop in unseren regnerischen Breiten unbedingt überdacht sein müssen, wurden dem denkmalgeschützten Vordach zwei Assistenten aus Stahl und Glas zur Seite gestellt, deren Spitzen sich vorsichtig unter die historische Betonschale schieben. Lage und Aussehen wurde vor allem dadurch bestimmt, daß eine unbehinderte Zu- und Ausfahrt gewährleistet sein mußte. Diesem Umstand ist es denn auch geschuldet, daß es sich bei den Zusatzdächern um Einbeiner handelt, eine Bauweise, die wegen der enormen Zugkräfte eine ungewöhnlich stabile Konstruktion erforderte, ein Aufwand, den man den beiden Hightechtürmen durchaus ansieht.
Die aus Ruinen wiederauferstandene Station hebt sich auch in etlichen Details deutlich vom standardisierten Durchschnitt ab. So kehrt etwa die dramatische Dachform im Eingangsbereich des Shops in einem sich nach hinten verjüngenden Muster von Halogenspots wieder. Obwohl sich im Inneren der Tankstelle die deutsche Liebe für Vorschriften in Form von Esso-üblichen Einheitsregalen durchsetzte, so spürt man doch sofort das besondere Ambiente. Zum Tankerlebnis trägt auch Herrn Toprakcis philantropische Ader bei, die unter anderen für das international zusammengesetzte Personal verantwortlich ist, eine Mixtur, die wiederum zum hier praktizierten architektonischen Eklektizismus paßt.