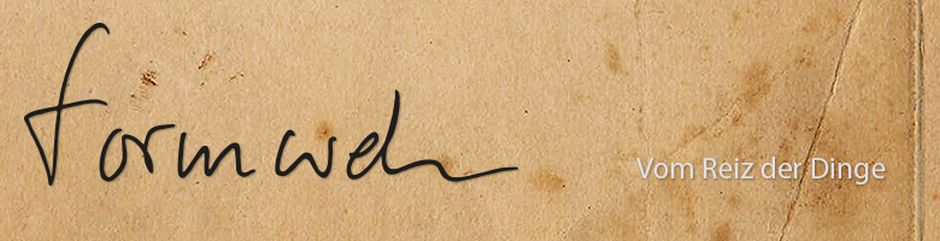In seiner Heimat widmet man ihm Ausstellungen. Außerhalb Großbritannien ist ein Name dagegen nur Eingeweihten bekannt. Dabei springt er einem von diesen schwer beladenen Büchertischen, die uns in der Fußgängerzone bewusst in den Weg gestellt werden und auf denen sich die Schöner-Wohnen-Titel stapeln, überall entgegen. Terence Conran – Sir, Urlondoner, Verleger, Stilberater, Highstreetexperte, Immobilienjongleur, Möbel- und Restauranterfinder -, der ständig mit Feingefühl irgendwelche Fäden zieht und dabei wie nebenbei noch die Welt beglückt, jedenfalls die Designwelt. Wir erinnern uns: Nachdem Maggie Thatcher die Gewerkschaften gekillt hatte, entwickelte der „Rote Tony“ (so nannte ihn seine Frau Cherie wegen seiner Vorliebe für rötliche Krawattenmuster) – also Ex-Premierminister Tony Blair entwickelte die neue Revolutionstheorie von „New Labour“. Die ging, um es noch einmal schnell zu wiederholen, kurz gesagt so: Das ganze Land ist eine Börse; alle spekulieren wie wild drauf los, und werden dabei reich und glücklich. Und um das auch zeigen zu können, braucht man viel Design, zuhause, beim Einkaufen und beim Essengehen (was die Briten mangels Lokalen zunächst allerdings noch selten unternahmen). Da kommt Terence Conran ins Spiel, ein Berater von Blair.
Man kennt ihn als freundlichen Geschäftsmann, Konzeptgastronomen und Museumsgründer, ferner als eifrigen Verleger, als Sanierer heruntergekommener Immobilien und als nimmermüden Anwalt der kaum weniger heruntergekommenen englischen Highstreet. Kurz: Conran, der 80-jährige, kann seine Hände einfach nicht still halten. Dauernd hat der Sohn eines Gummihändlers einen oder mehrere Fäden zwischen den immer noch flinken Fingern. Und in der anderen Hand glimmt eine echte Havanna, wozu ja schon Winston Churchill stark neigte – und auch der war immer für eine Überraschung gut.
Neulich zog Sir Conran mal wieder an einer ganz großen Strippe, und überraschte zur Abwechslung einmal die Deutschen – mit einem alten Toaster, der sich ertränkt, einem fleckigen Tuch, das zur Selbstverbrennung schreitet, und stumpfen Gläsern, die sich im Mülleimer entsorgen. Die Selbstmordserie des in die Jahre gekommenen Kücheninventars war ein 33 Sekunden kurzes Werbehighlight, eine gekonnte Parabel auf den Todesstrieb, der unserem Konsum innewohnt – und zugleich ein Verblüffungsmanöver von Tchibo, jener ansonsten eher humorlosen Ladenkette, aus deren Regalen die Ware aber ähnlich schnell verschwindet wie der Hausrat in dem animierten Filmchen. Man schrieb das Jahr 2008, da kam der deutsche Kaffeegroßröster angesichts sinkender Umsätze auf den Designtrichter: Bald gab es „Conrans Küche“, ein Sortiment von „Designaccessoirs“, die ein wenig teurer sein durften als die üblichen Schnäppchenangebote, die aber inzwischen natürlich auch längst ausrangiert sind. Auf dem Höhepunkt der Aktion blickten Conran Senior und sein Sohn Sebastian feierlich von schwarzen Plakatwänden auf deutsche Straßen herab – wo sie freilich bis heute niemand kennt.
In seiner Heimat ist der alte Conran hingegen eine Institution und wurde, wie dort üblich, für seinen Geschäftssinn von der Königin in den Adelsstand versetzt. „Das passt zu Tchibo“, frohlockte der Kaffeekonzern, und unterschätzte die kaufmännische Coolness des Sirs. Conran, der ja nun auch schon einiges mitgemacht hat und hier jetzt nebenbei noch eines seiner Einrichtungsbücher verscherbeln konnte, war hingegen völlig klar, dass die etwas peinliche Kampagne auch ruckzuck wieder vorbei und Schnee von gestern war.
Tenrence Conran hat die Lehren des „englischen Designs“ von der Pike auf lernen müssen. In der Zeit nach dem 2. Weltkrieg machte der Neuling in Textil- und Möbelgestaltung die Erfahrung, dass zwar er selbst modern war, seine Landsleute aber davon nichts wissen wollten. Es war zum Verzweifeln. Der Jungspund fand weder Händler noch Hersteller. So richtete er sich Mitte der 60er Jahre im Londoner Westen einfach selbst einen schicken Laden ein, etwas ab vom Schuss in der Fulham Road, aber in der Nähe des Chelsea College of Art, wo der Unternehmersohn Kunsthandwerk studiert hatte. Seinen Laden nannte er Habitat. Das war lateinisch (er, sie, es wohnt) und hörte sich gebildet an. Besonders die Gläser für verschiedene Nudelsorten (auch so etwas Modernes!) gingen von Anfang an so gut, dass er bald das nächste Geschäft aufmachen konnte, dann das nächste und das nächste und so weiter.
Conran ging irgendwann an die Börse und mischte jene Highstreet auf, um deren Erhalt er sich bis heute immer so große Sorgen macht. Nebenbei erfand er das englische Schickimickirestaurant, gründete einen Verlag für Einrichtungsbücher und war fortan der Meister der Lebensart. Dann kam sein regelrechtes Meisterstück: Als er an den ehemaligen Londoner Docks auch noch sein eigenes „Design Museum“ gründete, sanierte er die verrottete Gegend gleich noch mit. Hier hat sein Empire des guten Geschmacks seitdem seinen heimlichen Mittelpunkt. Da gab es bald auch eine kleine Buchhandlung, außerdem Schickimickirestaurants und jede Menge teure Eigentumswohnungen, in die bekanntlich viel Design hineingehört. Das war, ja richtig, Ende der 80er-Jahre und gefiel ihm alles in allem so gut, dass er seine Habitat-Kette einfach verkaufte (Ikea hatte gerade Bedarf an etwas Design).
Von nun an konzentrierte er sich voll auf die „Kreativindustrie“ und das kreative Sanieren, das er zu einer wahren Kunst entwickelte. Natürlich steigen nach dem Sanieren immer etwas die Preise, die sich der ein oder andere dann vielleicht gar nicht mehr leisten kann. Das ist unvermeidlich und hat ja auch Vorteile, da der weitsichtige Conran so seine nächsten Projekte besser finanzieren kann, was wiederum dann auch anderen Menschen zugute kommt. Das ist für den Aufklärer Conran, der dem Volk einfach viele „schöne Dinge“ gönnt, geradezu eine Herzensangelegenheit. Kaum einer anderer hat es geschafft, seine Designkundschaft so effektiv zu vermehren; man könnte es Designkreislaufwirtschaft nennen, ein ausgefuchstes Geschäftsmodell.
Wie sicher Terence Conran immer noch die Fäden in der Hand hält, zeigte sich neulich gerade wieder im Ostlondoner Stadtteil Shoreditch, der einst ein Slum war (und teilweise auch noch ist). Da wohnten einmal fast nur bengalische Einwandererfamilien, die in den „Sweatshops“ der Umgebung schufteten. Dann suchten sich in den 80er-Jahren junge Künstler hier billigen Atelierraum, das Viertel wurde hip. Studenten zogen nach. Seit in der direkten Nachbarschaft auch noch Londons Olympisches Dorf gebaut wurde, war dem Kenner klar, dass das Multikultipflaster bald gefragt sein würde. Conran zögerte nicht lange und eröffnete ein Café, nebenan noch ein Luxushotel mit Kellerrestaurant, Feinkostladen und Dachgarten. Das hob den allgemeinen Standard und, schwups, machte gleich um die Ecke eine Edelgalerie auf, vorsichtshalber mit Schutzmauer und Eingangsschleuse (man kann nie wissen – und so ausgefeilte Kontrollsysteme, wie wir sie aus Bagdad oder Los Angeles kennen, lassen sich doch problemlos auch auf andere Weltregionen übertragen). Da fällt einem doch gleich Vila Cruzeiro ein, jene Favela in Rio de Janeiro, die kürzlich durch starke Polizeikräfte von der Drogenmafia gereinigt wurde – und dabei praktisch selbst mit über die Wupper ging. Wo in der Nähe übrigens auch bald Olympische Spiele stattfinden, und wo spätestens jetzt der Nachholbedarf in Designdingen enorm sein soll.
Text nach: Bernd Polster, Und kann man darauf auch sitzen? Wie Design funktioniert, Köln 2011