Die alte Taschenuhr meines Urgroßvaters kommt aus einer Zeit, dem Kaiserreich, mit der wir scheinbar gar nichts mehr zu tun haben. Welch grandioser Irrtum. Wie alt mag es sein das gute alte Stück? Wann und aus welchem Anlass hat er sie wohl bekommen? Kurz vor dem 1. Weltkrieg vielleicht als er Anfang 20 und ein zorniger junger „Sozi“ war, geheiratet hatte und sein Sohn, mein Großvater, geboren wurde? Nach seinem Tod gehörte die Uhr dann zu den ganz wenigen Stücken, die nicht einfach achtlos in den Müll wanderten, sondern für die nächsten Jahrzehnte in einer Schrankschublade meiner Eltern verschwanden.
Denn obwohl hoffnungslos altmodisch, war es ja doch irgendwie ein „Wertstück“. Dass es auch ein Erinnerungsstück ist, familiär ohnehin, aber auch historisch, wie sollte denn das jemandem auffallen? Irgendwann in den 80er Jahren gelangte sie dann in meinen Besitz, weil ich sie irgendwie mochte. Und das lag weniger an der starken Dosis Nostalgie, die ich seit den Sechzigern auch intus hatte. Man denke nur an die Arzttasche, mit der ich nach der Schule rumrannte und die ich mit Idolen in Blubberschrift verziert hatte – und natürlich an die langen Haaare! Nein, das Motiv der spontanen Zuneigung war gerade das Gegenteil der Hippiewallungen: Die Einfachheit der Uhr löste eine latente Bewunderung aus. Ich habe sie zwar auch nicht getragen, aber gefühlsmäßig in Ehren gehalten. Und mit mir ist sie dann vermutlich ähnlich oft umgezogen wie mit meinem Urgroßvater, der wegen seiner sozialdemokratischen Ansichten schon öfter mal die Arbeitsstelle wechseln musste. Übrigens: Inzwischen lieben sie auch meine beiden Kinder als ein mysteriös attraktives Objekt aus galaktisch weit entfernten Vorzeiten.
Uropas zurückhaltend wirkende Uhr mit ihren schlanken schwarzen Zahlen auf dem weißen Zifferblatt wäre ein prima Anlass mal über den Wert der Dinge zu spekulieren (und ich meine ausdrücklich nicht den, den ich auf dem nächsten Antikmarkt oder bei Ebay vielleicht dafür erzielen könnte). Das klingt heute im Zeitalter von allgegenwärtigem Angeberdesign und galoppierender Aldisierung so altbacken wie die Uhr ja tatsächlich ist. Man muss sie mit einem Schlüssel aufziehen. Und doch ist sie auch ein Vorgänger des i-Pods, ein frühe Maschine für die Hosentasche. Und eben auch für die der kleinen Leute. Allerdings war auch dieser historische Vorgänger aller Portables ganz sicher ein Prestigeobjekt. Was früher ein Privileg der Reichen gewesen war, konnte sich nun im Kaiserreich auch ein einfacher Dreher leisten, ein Feinmechaniker, der er war. Die Uhr war also Zeichen eines gewissen Aufstiegs, wie später das UKW-Radio oder der Kleinwagen. Um so erstaunlicher ist es, dass die Uhr keinerlei überflüssigen Zierrat aufweist. Ihr einfaches Zifferblatt ist klar gliedert und sehr übersichtlich. Die römischen Ziffern sind nicht gerade gestellt, sondern folgen dem Kreis, was das Gesamtbild ruhig macht und damals so üblich war. Wahrscheinlich handelt es sich bei dieser Grafik einfach um einen handwerklichen Standard, der aus entsprechenden Musterbüchern übernommen wurde.
In einem Buch über Karl Marx entdeckte ich übrigens eine ganz ähnliche Uhr, die der Querdenker aus Trier besaß und geliebt haben soll. Die war natürlich um einiges älter. Naja, jedenfalls war ja mein Urgroßvater auch so eine Art roter Rebell, der zu wissen glaubte, was die Zeit politisch geschlagen hatte, und das in der Lüneburger Heide. Die klare Grafik des tickenden Schuckstücks passt aber auch in die Epoche um 1910, die Reformzeit, als man sich in Deutschland von der Dekorationswut des Historismus (und des Jugendstils) abwandte und schmucklose Formen und industrielle Materialien auch in der Architektur und auch bei Alltagsgegenständen Einzug hielten. Dafür stehen Gestalter wie Peter Behrens oder Richard Riemerschmidt und natürlich der neu gegründete Deutsche Werkbund.
Ob mein Urgroßvater davon je gehört hatte? Jedenfalls lebte die mit allgemeiner Skepsis gegen den allzu aufgetakelten Zeitgeist sowie die damit einhergehende Vorliebe für das Zweckmäßige sozusagen als vulgäre Variante der „Lebensreform“ in meiner Familie auch den folgenden Generationen weiter. Und als mir meine Eltern nach meiner Einschulung in die erste Klasse der Winsener Volksschule vorsorglich die erste Uhr kauften, weil nun der unerbittliche Rhythmus des wahren Lebens begann, war dies natürlich eine Armbanduhr. Und die war einfach, ziffernlos – aber vergoldet. Schließlich kam gerade das Wirtschaftswunder in Fahrt und alle wurden Wohlstandskinder. Von all den nun folgenden Moden, wie der übermächtigen japanischen Digitaluhr oder der schweizer Swatch-Welle, habe ich mich angewidert ferngehalten. Auch Quartzchronografen fand ich überflüssig und zumeist affig, selbst wenn die Marke Braun draufstand. Von der heute üblichen Angeberästhetik und dem damit einhergehenden „Design“-Gebrabbel gar nicht zu reden. Die Uhr ist ganz offensichtlich ein exzellentes Beispiel für die latente, mentale Seuchengefahr, die von diesem Gewerbe ausgehen kann. Und sie ist ein Musterbeispiel für jene unterlauteren Verkaufsmotive und -methoden, vor denen mich meine Großmutter immer gewarnt hat. Wer die Gewinnspannen von „Designeruhren“ mit Quartzwerk kennt, weiß wovon ich rede.
Ich erinnere mich an einen Satz von Heinz Heckhausen, der deutsche Motivationspapst, dessen Vorlesungen ich im Grundstudium der Psychologie an der Universität Bochum besuchen musste, ansonsten mit wenig Genuss. Doch als er einmal sagte, dass es Dinge gebe, wie zum Beispiel die Schrift, deren unaufhörliche Verbesserung wenig Sinn machen würde, weil die angeblichen Verbesserungen in aller Regel dem Zweck zuwider laufen, habe ich mir diesen Gedanken gemerkt – und auch auf die Uhr übertragen. Achtung! So wurde ich auch auf diesem Gebiet zum Fundamentalisten, der weder die Uhr noch das Rad verbessern will. In meinem Leben habe ich genau drei Uhren getragen, die sich, wenn ich sie so nebeneinander lege, schon erstaunlich ähnlich sind. Ist das nicht schrecklich langweilig? bp
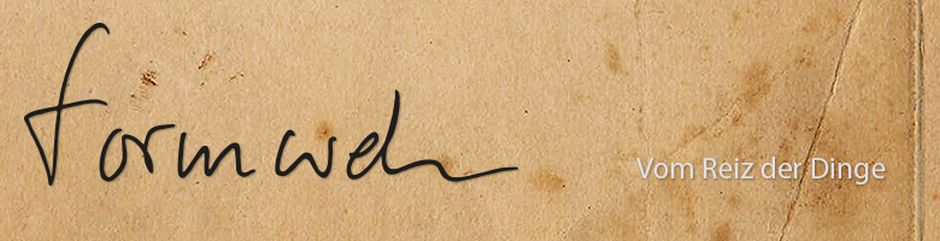






Interessante Hinweise! Ich werde mich damit mal intensiver beschäftigen! Bin gespannt auf die naechsten Eintraege!
Ein wirklich schöner Gedanke. Ur-Portable trifft es auf den Punkt ..)
So gesehen war die (Taschen)Uhr doch zu ihren Anfängen nichts anderes als ein Gebrauchsgegenstand, der einem das Privileg einräumte zu jedem Moment die Zeit zu wissen.
Ich glaube das „schmücken“ der Uhr ging trotzdem sehr früh los. Schließlich ist die Form ja schon gegeben. Wahrscheinlich sogar begannen die Uhrmacher aus langeweile, immer das gleiche Antlitz vor sich zu haben, die Uhr zu verzieren. Trotzdem hat sich bis heute das typische klare Bild erhalten. Finde ich schön. Alle vier „Ur-Portables“ finde ich übrigens auch sehr schön.
Hat sich gelohnt mal wieder bei formweh reinzuschauen 🙂
Hallo René, danke für die Blumen. Schick doch mal dein Lieblingsobjekt. Fällt mir (und dir) sicher was zu ein .. bp