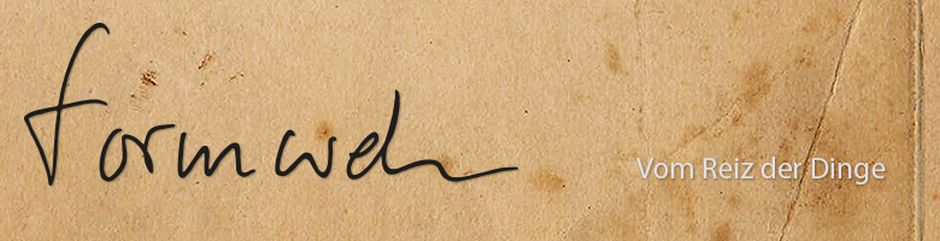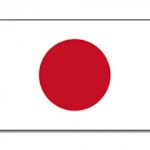Zur Vorgeschichte des „red dot“. „das für grafiker bedeutendste beispiel eines emblems ist der rote punkt auf einem weißen feld, das zeichen für japan. da ist nichts wegzunehmen, nichts hinzuzufügen. auch wenn es einfacher nicht mehr geht“, schreibt der Grafiker Otl Aicher, in seinem 1991 erschienenen Buch die welt als entwurf. Es gibt aber mittlerweile noch einen Punkt gleicher Farbe, der durch die Medien geistert: der Designpreis „red dot“, der alljährlich vom Designzentrum Nordrhein-Westfalen vergeben wird. Dabei handelt es sich um eine der weltweit bekanntesten Auszeichnungen ihrer Art, was Preisverleiher und Preisträger natürlich erfreut. Der „Rote Punkt“, wie der „red dot“ ursprünglich hieß, ist selbst eine prägnante und erfolgreiche Marke, die auf Aicher zurückgeht, einem ästhetischen Asketen, der darin ein Ideal verwirklicht sah.
Auf der Homepage des Designzentrums, heute „red-dot.de“, könnte man dagegen den Eindruck gewinnen, Peter Zec, der langjährige Leiter des Zentrums, müsse wohl der Urheber der Punkt-Idee sein. Man liest dort unter anderem, diese stamme „aus der Feder von Otl Aicher und dem Kopf von Peter Zec“. Was soll das bedeuten? Aicher, einer der Großen des Corporate Design, war eigentlich dafür bekannt war, dass er intensiv seinen Kopf benutzte. Außerdem war er berühmt und geradezu berüchtigt dafür, niemals halbe Sachen zu machen. Aicher, der Ganz-oder-Garnicht-Mann, ist Urheber des Konzepts „Roter Punkt“, das nahtlos in sein Portfolio passt und in dem zwei Grundanforderungen an gutes Design verschmelzen, nämlich Reduktion und Innovation. „es bringt nichts, das schachbrett um eine farbe zu bereichern, der spielmöglichkeiten gibt es genug. spiele setzen reduktion voraus“, brachte er 1966 seinen kategorischen Minimalismus in ein prägnantes Bild.
Welche Rolle der unerfahrene Zec bei diesem kreativen Prozess gespielt haben könnte, bleibt ebenso unklar wie die Geburtsumstände des Designpreises. Zec selbst sagt in Interviews, das Signet gehe auf die gängige Praxis von Galeristen zurück, verkaufte Bilder mit roten Punkten zu markieren. Beim Verkaufen kennt er sich aus. Könnte nicht – neben Aichers Flaggensymbolik – eher ein spektakuläres Ereignis aus den Sechzigerjahren als Inspiration gedient haben (das Zec nicht erwähnt). 1969 boykottierten Schüler und Studenten in Hannover Busse und Straßenbahnen wegen überhöhter Fahrpreise und organisierten gleichzeitig einen freiwilligen Ersatzfahrdienst. Autofahrer, die bereit waren, umsonst Mitfahrer mitzunehmen, klebten sich einen roten Punkt an die Windschutzscheibe. Diese Kampagne, die auf zahlreiche Städte in der ganzen Bundesrepublik übersprang, nannten die Protestler „Rote-Punkt-Aktion“. Eine Wortschöpfung.
Das Designzentrum Nordrhein-Westfalen war 1953 als Verein Industrieform in Essen gegründet worden, wo es auch die renommierte Folkwangschule für Gestaltung gab. Der rührige Verein wurde laut hauseigener Website 1990 – nach drei Umzügen – im Geiste der Achtzigerjahre in „Designzentrum“ umgetauft. Ein Neubeginn: Das damit verbundene neue Erscheinungsbild der Einrichtung – inklusive „Roter Punkt“ – entwarf Otl Aicher. Es wurde offenbar 1991 eingeführt. In diesem Jahr, dem Todesjahr von Aicher, kam Manager Zec ans Designzentrum. 1997 zog man zum letzten mal um, nun in die überflüssig gewordene und für den neuen Zweck großzügig renovierte Zeche Zollverein. Drei Jahre später entschied ihr neuer Leiter, den erfolgreichen „Roten Punkt“ in „red dot“ umzutaufen, angeblich weil, so die hauseigene Website, „der deutsche Name in der internationalen Designwelt schwerlich zu übersetzen“ sei. Das ist schwerlich zu verstehen, zumal wenn ein paar Zeilen vorher darauf hingewiesen wird, dass im Ausland damals von „Punto Rosso“ und „Point Rouge“ gesprochen wurde.
Könnte es nicht viel mehr so sein, dass der Umschwung weniger kommunikative oder ästhetische Ursachen hatte, sondern eher eine Frage der Rechte und der damit verbundenen Geldflüsse war. Beim „reddot“-Komplex hat jedenfalls nun Peter Zec die Hände im Spiel. Im übrigen handelt es sich bei der Umfirmierung um einen Sprachwechsel, der stets mit unvermeidlichen Bedeutungsverschiebungen verbunden ist. Im Englischen gibt es verschiedene Begriffe für Punkt. Die bekanntesten sind „point“, „full stop“, „spot“ und „dot“. Der Aicher’sche „Punkt“, auf den sich eine Sache reduziert, zielte auf Exaktheit. Dagegen steckt in „dot“ die Anspielung auf das flüchtige „dot-com“ des Internets sowie auch der amorphe Fleck, den mancher auf der Weste hat. Zec wollte nicht exakt sein, sondern weg vom Formasketen Aicher und dessen Schachbrett verbessern. Aus einem Punkt wurde nicht nur ein „dot“, sondern schließlich auch ein Globus, der sich – in der Art einer Spirale oder eines geschälten Apfels – heutzutage im Webuniversum unaufhörlich um sich selbst dreht. Nicht als Symbol, dass jemand etwas auf den Punkt gebracht hat, sondern – so lehrt uns red-dot.de – für die schöne, neue „faszinierende Welt des Designs“ .. bp