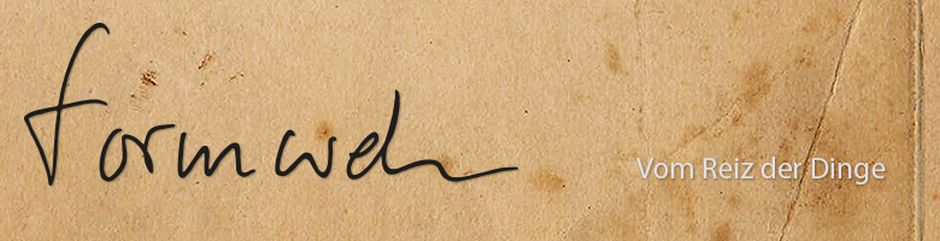Es ist schon eine liebe Gewohnheit: Ausstellungen, auch wenn sie keinen Bezug zu Amerika oder Großbritannien haben, bekommen einen englischen Titel verpasst. Bang! Just like that. Drei aktuelle Beispiele für solchen offensichtlichen Unsinn sind Gypsy Urbanism (über den Wiener Volksaufklärer Otto Neurath), less and more – Das Design Ethos von Dieter Rams (Deutschlands Vorzeigedesigner wohnte zeitlebens in Hessen) und The Best of Dutch Design (eine Auswahl niederländischer Produkte, die in Essen gezeigt wird). Was treibt gerade die Museen in eine kollektive Sprachflucht?
Natürlich haben mir aufgeklärte Mitmenschen klar gemacht, dass es sich bei dieser neumodischen Namensgebungspraxis eben um Marketing handelt. Soll heißen: Ein englischer Titel peppt sogar eine langweilige deutsche Ausstellung noch auf. Warum soll, was bei Hollywoodfilmen, Stühlen und Damenbinden funktioniert, nicht auch für Designausstellungen gut sein?
Da wir die tieferen Gründe für den chronischen Hang der Deutschen im allgemeinen und der Designausstellungsmacher im besonderen zum überflüssigen Anglizismus hier nicht aufklären können, seien zumindest ein paar sprachkritische Anmerkungen erlaubt. Dass Gypsy Urbanism der Titel einer amerikanischen Dissertation ist, darauf ist hingewiesen worden. Die Übernahme, die wohl Internationalität suggerieren soll, zeigt jedoch eher ein erschreckendes Defizit an Selbstbewusstsein. Hinzu kommt, dass „Zigeunersiedler“, wie es damals im Wiener Volksmund hieß und worauf der amerikanische Titel anspielt, natürlich nicht pc ist. Es hätten sich aber reichlich andere starke zeitgenössische Wortschöpfungen angeboten, klingende Begriffe wie etwa „Brettldörfer“ oder „Isotypen“.
Was Dieter Rams betrifft: Die Ausstellung „less and more“ lief unter diesem Titel gerade im Londoner Design Museum. Den Haupttitel haben die Frankfurter englisch belassen, den Untertitel übersetzt. Wobei man sich – als kleine anglizistische Zugabe – beim Design-Ethos den deutschen Bindestrich gespart hat. „less and more“ ist natürlich eine Anspielung auf den berühmten Ausspruch „weniger ist mehr“ von Ludwig Mies van der Rohe, mit dem dieser in den 20er Jahren sein minimalistisches Credo aphoristisch zuspitzte. In den USA wurde der Einwanderer Mies dann später eins-zu-eins mit „less is more“ übersetzt. Dies wurde zum erfolgreichen Slogan (ähnlich Louis Sullivans „form follows function“). In den postmodernen 80er Jahren kursierte dann aber auch die persiflierende Variante „less is bore“. Die Londoner Formulierung „less and more“ ist im Vergleich dazu schlapp und bringt keinen über das Originalzitat hinausreichenden Erkenntnisgewinn. Ihr Sinn liegt offenbar vor allem darin, eine Parallele zwischen Mies und Rams zu ziehen. In der Entscheidung der Frankfurter, den Titel englisch zu belassen, vermag ich keine Logik zu erkennen. Es sei denn, man würde die schlichte Tatsache, dass eine Rams-Ausstellung in London stattfand, als Begründung akzeptieren. Vielleicht wäre ja auch bei einer Rückübersetzung zu „weniger und mehr“ die Banalität zu sehr ins Auge gefallen.
Über die Beziehung von Dieter Rams zur englischen Sprache ist wenig bekannt. In einem Interview hat er mir einmal folgende Geschichte erzählt: Als seine Rolle bei Braun Ende der 50er Jahre prominenter wurde und sich internationale Kontakte ergaben, sah er Nachholbedarf im Englischen. Dies sei ein wichtiges Motiv gewesen, den tragbaren Plattenspieler P1 zu entwickeln (der dann mit dem Transistorradio T41 kombiniert wurde). Er konnte das Gerät mit auf Reisen nehmen und darauf auch unterwegs die Sprachkurse abspielen, die damals in der Regel auf 45er-Single-Schallplatten angeboten wurden.
Zum Schluss noch The Best of Dutch Design. Unsere holländischen Nachbarn -bekannt als rückhaltlose Freunde des Anglizierens – nennen ihren nationalen Designpreis tatsächlich Dutch Design Award. Andere Länder, gleiche Sitten. Da konnten sich die Essener Gesinnungsfreunde natürlich nicht zurückhalten und haben gleich, wie sie es gewohnt sind, noch ein „Best of“ drangeklebt, so als wäre es eine CD mit ausgewählten und allseits bekannten Hits. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Was sich anhört wie eine kuratierte Ausstellung ist eben nur der Schnappschuss prämierter neuer Produkte, die sich allesamt erst noch durchsetzen müssen. Etikettenschwindel hin und her. Sonst wäre wahrscheinlich überhaupt keiner hingegangen .. bp