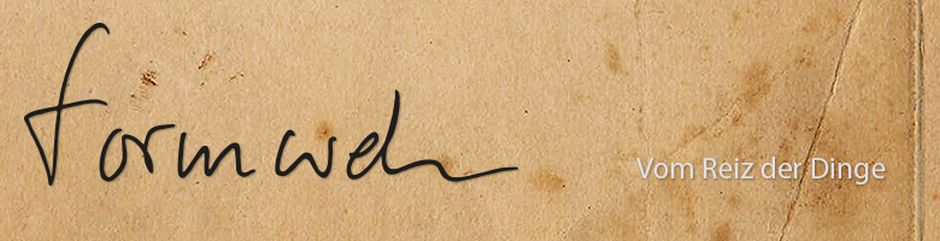Aus dem Regal der außerordentlichen Bücher: Gregory Bateson u.a., Schizophrenie und Familie, Frankfurt am Main 1969 (aus dem Englischen von Hans-Werner Saß), Taschenbuch, 424 Seiten
Dies ist eines der ganz wenigen Bücher, die ich während meines Psychologiestudiums mit großem Interesse gelesen habe. Deshalb steht es in meinem „Regal der einflussreichen Bücher“, von denen ich demnächst an dieser Stelle noch mehr vorstellen werde. Es ist eine Aufsatzsammlung, die zuerst in den USA erschien und Strukturen der Familie behandelt, die seelisch krank machen. Zwischendurch war es übrigens mal verschwunden (wahrscheinlich auf ewig verliehen). Ich habe es mir – ZVAB sei Dank – schon vor Jahren wieder besorgt und komme nun bei meinem aktuellen Buchprojekt wieder darauf zurück. Wer hätte das gedacht? Bei meiner Arbeit an der Gropius-Biografie ist mir aufgefallen, dass Walter G. auch ein Virtuose des „Double-Bind“ war, diesem Aussenden widersprüchlicher Signale: eine Zwickmühle, auf die das Gegenüber nicht antworten kann und, wenn es nicht ausweichen kann, in verwirrenden Gefühlen verstrickt. Also eine perfide Falle, die wie auch im Falle von Gropius mit ausgesprochener Freundlichkeit einhergehen kann. Ganz besonders die Frauen, die ihn liebten, hat er so in die Ecke getrieben. Im Extremfall führt das zu dem, was man „Schizophrenie“ nennt. In Familien, wo die Abhängigkeiten groß sind, passiert das offenbar häufig. Warum werden solche grundlegenden Sachen eigentlich nicht in der Schule gelehrt?
Auch ein zweiter zentraler Begriff des Buches scheint auf ihn zuzutreffen. Gropius hat das Bauhaus als „Pseudogemeinschaft“ eingerichtet, ein scheinbar egalitäres Miteinander, das von ihm aber strikt autokratisch geführt wurde. Wie die Gutshöfe seiner Jugend und wie eine Sekte, einer der Prototypen der Pseudogemeinschaft. Schizophrenie und Familie, angesiedelt in der Schnittmenge von Kommunikationstheorie und Anti-Psychatrie, war ein Frontalangriff auf die Schulpsychatrie, insbesondere die deutsche, auf deren Portal seit Gründung die „Gehirnkrankheit“ stand. Und heute, in Zeiten von Gehirn- und Pharmaforschung, immer noch steht. Ein Beitrag von Ronald D. Laing beschäftigt sich mit der schädlichen Wirkung der Mystifizierung auf das Gemüt. Der Brite Laing, selbst Psychiater, bekämpfte die „mystifizierende Verdinglichung“ psychologischer Begriffe, die selbst Kommunikationsfallen sind. Auf solchen Gedanken habe ich übrigens meine Diplomarbeit aufgebaut, ein totaler Abgesang auf die akademische Psychologie. Die sich natürlich nicht darum geschert hat, mir aber trotzdem den Diplomorden umgehängt hat – ein klassischer Fall von Double-Bind und Pseudogemeinschaft.
Ich habe das Buch nie ganz, sondern nur auszugsweise gelesen. Es hat mir aber wichtige Denkantöße gegeben, wie die genannten Begriffe, die sich meiner Ansicht nach auf viele Situationen anwenden lassen, nicht nur auf die Familie, sondern zum Beispiel auch auf die Schule und eben auch auf die Psychologie selber. Das weiße inzwischen reichlich angeschmutzte Buch, das sehr einfach und schön gestaltet ist – höchstwahrscheinlich von Willy Fleckhaus – gehört zur Reihe „Suhrkamp Theorie“. Herausgegeben von Jürgen Habermas und anderen. Offenbar liefen in den Sechziger- und Siebzigerjahren selbst solche anspruchsvollen Titel noch gut. Immerhin waren 1972, wie man im Impressum erfährt, schon fast 10.000 Exemplare verkauft. bp